
Die Tracht als Genre
Trachtendarstellungen erreichten ihren ersten Höhepunkt gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich das Genre zu formieren begann und alsbald zum Repertoire zahlreicher Schweizer Kleinmeister gehörte. Wie bei den Stadt- und Landschaftsansichten nahm Johann Ludwig Aberli auch hier eine Vorreiterrolle ein, indem er Trachtenbilder mit der von ihm entwickelten kolorierten Umrissradierung ausführte, um grössere Auflagen zu erreichen. Wie kein anderes Motiv repräsentierte die Tracht in ihrer Vielfalt an Farbigkeit, Schnitt, Materialität und Verzierung die regionale Diversität und verkörperte gleichzeitig das aufklärerische Gedankengut einer vermeintlich idyllischen und naturbezogenen Schweiz.

Reiseandenken
Die drei Lehrmeister von Franz Niklaus König – Marquard Wocher, Balthasar Anton Dunker und Sigmund Freudenberger – zählten zum künstlerischen Kreis um Johann Ludwig Aberli. Mit ihrem spezifischen Bildvokabular prägten sie die frühen Trachtenbildnisse, welche sich am aufkommenden Tourismus orientierten und zu beliebten Reisesouvenirs avancierten.
Das Blatt von Dunker zeigt sich in der damaligen typischen Manier mit zentrisch positionierten Figuren in regionaltypischer Tracht. Eingebettet in eine generalisierte Landschaft, bereichert mit landwirtschaftlichen Gegenständen, ermöglicht das seitliche Profil eine plastische Sicht auf die Kleidung. Der tief liegende Horizont, der an die kleinmeisterlichen Stadt- und Landschaftsansichten erinnert, führt das Auge von der gleichsam haptischen Rezeption in die Weite des Firmaments.
Französische Einflüsse
Während seines zweiten, acht Jahre dauernden Aufenthalts in Paris setzte sich Sigmund Freudenberger beeinflusst durch Johann Georg Wille und François Boucher mit der höfischen Kunst auseinander, die sich durch die Interaktion von Mode, Interieur und Handlung auszeichnete. Nach seiner Rückkehr setzte Freudenberger die neu gewonnenen Kenntnisse in seinen Genreszenen gekonnt ein. Obschon die Raumausstattung der Berner Bauernhäuser um einiges bescheidener war als diejenige in den bourgeoisen Interieurs, wirkt seine Protagonistin in ihrer anmutigen Haltung nicht weniger apart als ihr nach französischer Mode gekleidetes Pendant. Das künstlerische Vermächtnis Freudenbergers beschränkt sich nicht nur auf die Manifestation in der visuellen Kultur. Seine Bilder dienten als Vorlage für die «Freudenberger-Tracht», welche bis heute im Emmental getragen wird.




Trachtenmode
Sigmund Freudenbergers Schüler Franz Niklaus König bringt die modische Innovation in der Gegenüberstellung einer alten Frau in altmodischer Rokoko-Tracht und einer jungen Frau in neumodischer Empire-Tracht exemplarisch zur Anschauung. Ab der Wende zum 19. Jahrhundert wurden die Schweizer Trachten von der französischen Empire-Mode beeinflusst. Besonders die Berner Tracht erfuhr eine gänzliche Überarbeitung. Neu wurde der Mieder am unteren Saum mit dem Rock zusammengenäht und das «Wessli» reichte noch knapp bis zur Brustmitte. Die didaktische Note bei Franz Niklaus König täuscht darüber hinweg, dass seine Darstellung durchaus authentische Elemente enthält. Die Trachtenforscherin Julie Heierli bemerkt jedoch, dass Bäuerinnen niemals in ihren Kirchenhauben auf den Markt zogen, um dort ihre Produkte zu verkaufen.

Die Tracht als politisches Statement
Die Niederlage gegen die Franzosen im Jahr 1798 verarbeitete Franz Niklaus König noch im selben Jahr mit dem Aquarell «Le Landsturm». Als Artilleriehauptmann führte er die Truppen der Berner Oberländer an. Trotz anfänglichem Widerstand entschieden die Gegner die Kämpfe für sich. Das historische Ereignis wird mit dem Aufbegehren der bernischen Landbevölkerung gegen die französische Besatzung dargestellt. Die später entstandene lithographische Reproduktion zeichnet sich, wie das Original, durch einen dynamischen Gestus aus, den König mit kompositorischen Mitteln und künstlerischer Ausführung belebte. Der Blick wird unmittelbar auf die farbigen Trachtenkleider in den vordersten Reihen gelenkt. Die Tracht funktionierte in diesem Kontext als Metapher für den politischen Widerstand am Wendepunkt vom Ancien Régime zur Helvetik.

Schweizerreisen
Die Berner Alpen entwickelten sich in Anbetracht künstlerischer Beiträge aus Literatur und Malerei zu einem begehrten Reiseziel. Die beschwerliche Anreise und zunehmende Unruhen Ende des 18. Jahrhunderts konnten der wachsenden Anzahl Reisender nichts anhaben. Auch Franz Niklaus König zog 1797 mit seiner Familie ins Berner Oberland, um sich in der unberührten Natur und befreit von städtischen Ablenkungen auf die Arbeit an seinen Bildern zu konzentrieren. Seine Reproduktion eines um das Jahr 1804 entstandenen Ölgemäldes besticht durch sein Licht- und Schattenspiel. Effektvoll werden Bildausschnitte wie der imposante Staubbachfall mit einer Höhe von 297 m oder die Staffagefiguren im vorderen Bildbereich beleuchtet, während andere Bildpartien im Dunkeln bleiben. Die touristische Gruppe im Vordergrund wird dadurch raffiniert hervorgehoben. Gekleidet in städtischer Mode steht sie im Kontrast zu den Trachten der Bewohner und Bewohnerinnen des Lauterbrunnentals.

Arkadische Landschaft
Als Mitorganisator und Quartiermeister der ersten beiden Unspunnenfeste von 1805 und 1808 vermittelte Franz Niklaus König sein Schweizbild den Reisenden vor Ort. Das Fest verfolgte auch kulturpolitische Absichten: Die junge Nation sollte gestärkt und vermeintlich altehrwürdige Traditionen wiederbelebt werden. Künstlerisch wurden die Feierlichkeiten als arkadische Landschaftsdarstellung wiedergegeben. Umgeben von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern übten sich Alphirten im Steinstossen und Schwingen. Die Vielfalt der dargestellten Kleidung verweist auf die unterschiedliche Herkunft der Teilnehmenden, die zumindest bei diesem Anlass eine untergeordnete Rolle einnahm – ganz im Sinne eines vereinigenden Grundsatzes.

Touristische Attraktionen
Der werbewirksame Effekt der Unspunnenfeste liess nicht lange auf sich warten. Viele ausländische Touristen besuchten anschliessend das Berner Oberland, darunter der König Friedrich I. von Württemberg oder die französische Malerin Élisabeth Vigée-Lebrun. Als Reiseführer brachte Franz Niklaus König seine Gäste zu malerischen und spektakulären Plätzen. Besonders die Besuche zu den naheliegenden Wasserfällen gehörten zu den Hauptattraktionen, wie die Szenerie auf einem Fährboot illustriert. Zwei Ruderinnen bringen die Fremden von Brienz zu den Giessbachfällen. Mit der Beschriftung «Chr. Fischer» auf der Überdachung ist wohl der bekannte Holzschnitzer Christian Fischer gemeint, der seine Schnitzkunst an Reisende verkaufte und den Grundstein für die heutigen weltbekannten Brienzer Holzschnitzereien legte.


Souvenir und Sentiment
Die Bootstouren zu den Giessbachfällen erfreuten sich auch angesichts der Schifferin Elisabeth Grossmann grösster Beliebtheit, deren ausserordentliche Schönheit europaweit bekannt wurde. Die tragische Geschichte einer untersagten Liebe zu einem jungen Professor aus Neuenburg lieferte den notwendigen Stoff, um ein helvetisches Märchen zu erschaffen. Verschiedene Kleinmeister porträtierten die Protagonistin von liebreizend bis hin zu einer verführerischen Figur. Franz Niklaus König zeigt sie in der modernisierten Berner Tracht mit kokett drapiertem Schwefelhütchen. Als Motiv für seine Transparentbilder offenbart sie sich in gleichem Zauber.
Trachtenbildnisse
Als in vielen künstlerischen Techniken und Genres ausgebildeter Maler führte Franz Niklaus König im Berner Oberland zunächst Auftragsarbeiten in der Porträtmalerei aus. Sein 1798 entstandenes Aquarell einer Bäuerin des Oberhasli lehnt sich an diese Praxis an. Weniger aufgrund der weiblichen Figur in der Tracht des Haslitals, als aufgrund der stilistischen Einbettung in die idyllische Landschaft, die in Rokokomanier ausgeführt ist. Das Aquarell diente unverwechselbar als Vorlage für die «Oberhaslerin» in seinem 1811 erstmals erschienen Trachtenzyklus «Kleiner Trachtenkönig».



Kalenderkupfer
Auch bei den zwischen 1799 und 1820 jährlich erscheinenden Ausgaben des Neuen Helvetischen Almanachs wirkte Franz Niklaus König als Illustrator mit und publizierte eine Vielzahl seiner Trachtendarstellungen im Kleinformat. Die jeweils zwei- bis dreifarbig kolorierten Bilder ergänzten den Kalenderteil, welcher in der Helvetischen Republik der republikanischen Zeitrechnung entsprach. Das Blatt «Ein Unterwaldner» findet sich im Monat «Prairial», der jeweils vom 20. Mai bis zum 18. Juni dauerte. Die lässige Pose des Unterwaldners mit den überkreuzten Füssen und der abgestützten Haltung ist eine stereotypisierte Darstellungsform männlicher Trachtenfiguren. Am Ende des Büchleins wurden die Radierungen jeweils mit kürzeren Kommentaren interpretiert.

Ländliches Gesellschaftsideal
Die im Neuen Helvetischen Almanach publizierten Radierungen, welche auch zum umfangreichen Zyklus «Kleiner Trachtenkönig» mit 60 Blättern und insgesamt 75 Varianten zählen, wurden von Verlegern aus Zürich und Paris in den Jahren 1811 und 1820 in gebundener Form mit dem Titel «La Suisse en miniature» erneut publiziert. Das Bildprogramm lehnte sich an die damalige Praxis ethnografischer Schautafeln an, deren freigestellte Figuren mit den universell gehaltenen Physiognomien die Bekleidung in den Mittelpunkt setzte und die Vielfalt ländlicher Traditionen widerspiegelte. Mit ausführlichen Beschreibungen zu Wesensart und Tracht erhielten die idealisierten Bilder einen realitätsbezogenen Anspruch.

Grosser Trachtenkönig
Der bereits um 1801 erschienene «Grosse Trachtenkönig» entstand hingegen nach den Trachtenbildnissen des luzernischen Malers Josef Reinhard. Im Auftrag des Seidenfabrikanten Johann Rudolf Meyer bereiste Reinhard zwischen 1788 und 1797 die Schweiz und porträtierte ausgewählte Personen aller Kantone und Regionen in ihren typischen Festtagstrachten. Bei der Anfertigung der Druckgrafiken befanden sich die 136 Tafeln in Meyers Schloss in Aarau, wo sie nur einem ausgewählten Publikum zugänglich waren. Vielleicht trug dieser Umstand zur Publikation von Franz Niklaus König bei, denn diese ermöglichte die Verfügbarkeit zumindest einer Auswahl der Tafeln ausserhalb des privaten Rahmens. Die Ausführung der Druckgrafiken nimmt mit der Wahl des aussergewöhnlich grossen Papierformates und der Technik der Weichgrundradierung Bezug auf die Bildtafeln Reinhards.

Verlegerische Absichten
Ein Jahr vor dem ersten Unspunnenfest von 1805 publizierte Franz Niklaus König seinen «Mittleren Trachtenkönig». Darin legte er die Bildtafeln des «Grossen Trachtenkönigs» in verkleinerter Form und mit ergänzenden Erklärungstexten neu auf und verfolgte damit wohl eindeutige merkantile Interessen.
La présente collection de costumes suisses est proprement le diminutif de celle que, il y a quelques années, je publiai en grand format; et celle-ci ayant généralement été bien accueillie, je ne me suis permis aucun changement ni à l'égard des habillements, ni à celui des divers caracteres. J'ai cru nécessaire de faire accompagner l'une et l'autre d'un texte explicatif, tant en allemand qu'en français. Un format plus agréable et des prix plus bas pourront compenser ce qui, dans la présente édition, n'atteindroit pas la perfection des caracteres et la touche des têtes qu'on a remarquées dans celle en grand format […]
Franz Niklaus König, Collection de Costumes Suisses tirés du Cabinet de Mr. Meyer d'Aarau, Vorwort, S. unpag.

Swiss Costumes
Josef Reinhard wiederum befasste sich in seinem späteren Schaffen selbst mit dem druckgrafischen Medium. Seine Trachtenbilder für die englische Publikation «A collection of Swiss costumes in miniature» erschienen erstmals 1822 beim Londoner Verleger James Goodwin und erhielten internationale Anerkennung. Ihre Bildsprache knüpft an frühere Vorbilder an: Der Hintergrund wirkt oft wie das flächige Wandbild eines Innenraumes, vor dem eine Figur situiert wurde. Die Beschreibungen in Englisch und Französisch beinhalten ähnliche ethnographische Aspekte wie die Kommentare zu den Radierungen des «Kleinen Trachtenkönigs» von Franz Niklaus König. Ihr Fokus liegt jedoch nicht auf der detailgetreuen Wiedergabe der Kleidung, sondern auf den geographischen Besonderheiten der vorgestellten Regionen.
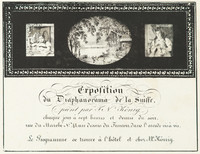
Das Transparenten-Kabinett
Franz Niklaus Königs luministischer Stil erfuhr in späteren Jahren hingegen mit seinen Transparentbildern eine neue ästhetische Bedeutung. Dabei griff König die Idee bemalter Lampenschirme auf und übertrug das Konzept auf grossflächige Aquarelle, die in den eigens dafür konstruierten Diaphanorama-Kasten eingespannt und rückseitig beleuchtet wurden. Durch seine Tätigkeit als Theatermaler mit der Beleuchtungsthematik betraut, wurden die lichtmedialen Eigenschaften mit Bildthemen seines bisherigen Œuvres umgesetzt. Die Resonanz auf die Vorführungen im Transparenten-Kabinett in Bern war so gross, dass sie einem begeisterten Publikum in der Schweiz, Deutschland und Frankreich gezeigt wurden, darunter in Weimar Johann Wolfgang von Goethe oder in Paris Élisabeth Vigée-Lebrun und dem Herzog Louis-Philippe von Orléans.

Medialität beleuchteter Bilder
Einer der Anwesenden in Paris war Louis Daguerre. Inspiriert vom Licht- und Illusionseffekt, eröffnete er im Jahre 1821 ein Diorama, dessen Bezeichnung sich an Königs Diaphanorama anlehnt. Insofern wurde Daguerre’s Pioniergeist von den Transparenten Königs massgeblich vorangetrieben.
[…] Als Zwischenspiel, indessen die Hauptbilder verändert werden, lässt Herr König zehn Seitenbilder sehen, verschiedene Schweizertrachten vorstellend, Halbfiguren und Kniestücke, mehrere mit landschaftlichen Gründen begleitet. Anziehend erscheinen die beiden Bauernmädchen am Fenster, eine Einzelne in der malerischen Luzernertracht, die beiden aus Zug, deren eine der andern die Haare flicht. Zu diesen möchte auch als vorzüglich geraten der Berner Küher (Kuhhirte) zu zählen sein […]
Johann Heinrich Meyer, Transparent-Gemälde, in: Johann Wolfgang Goethe, Ästhetische Schriften 1816-1820: Über Kunst und Altertum I-II, 1999, S. 527.